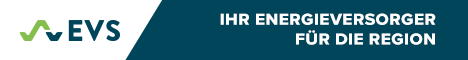Über 200 Fachleute diskutieren beim Wahrendorff-Symposium „Boulevard of Broken Dreams“

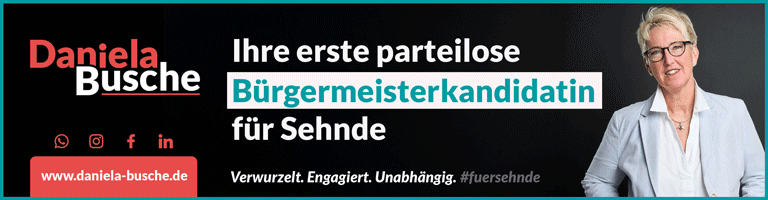
Angesichts zunehmender psychischer Belastungen durch Krisen, Gewalt und Unsicherheit rückt die Debatte über moderne Traumatherapien stärker in den Fokus. Wie Versorgung, Praxis und Forschung diesen Herausforderungen begegnen können, diskutierten über 200 Fachleute aus Psychiatrie, Medizin, Psychotherapie und Sozialer Arbeit im Mai 2025 auf einem Symposium des Wahrendorff Klinikums Köthenwald. Unter dem Titel „Boulevard of Broken Dreams“ tauschten sie sich über aktuelle Entwicklungen in der Trauma- und Schematherapie aus, knüpften Kontakte und beleuchteten neue Ansätze der traumatherapeutischen Versorgung. Im Mittelpunkt standen Perspektivwechsel, die Praxis und Forschung gleichermaßen voranbringen.
Wissenschaftlicher Auftakt und kritische Perspektiven
Professor Dr. Marc Ziegenbein, Ärztlicher Direktor, eröffnete das Fach-Symposium und gab einen ersten Einblick. Die Klinik für Trauma- und Schematherapie im Wahrendorff Klinikum behandelt Traumafolgestörungen nach Gewalterfahrungen oder belastenden Lebensereignissen und ist auf Schematherapie spezialisiert. Diese Therapieform richtet sich an Menschen mit komplexen psychischen Belastungen, die vor allem in Kindheit oder Jugend entstanden sind. Im Fokus stehen Posttraumatische Belastungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen und Affektive Störungen.
Dr. Philip Negt von der Leibniz Universität Hannover bereicherte die Veranstaltung mit seinem Überblicksvortrag „State-of-the-art: Schematherapie und Traumafolgestörungen“. Danach fand ein weiterer Beitrag besondere Beachtung: Jana Meyer, Psychologin im Wahrendorff Klinikum, sprach über „Die Metamorphose der Caenis – Trauma, Trans* und Selbstbestimmung“. Sie beleuchtete die psychische Gesundheit von trans* Personen im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichem Druck und persönlicher Identitätsfindung. Den Begriff trans* verwendete sie als Oberbegriff für Menschen, die sich dem Gegengeschlecht, einem weiteren, keinem oder mehreren Geschlechtern zugehörig fühlen. „Trans* Identität ist keine Abweichung, sondern eine Variante der Norm“, betonte sie. Es sei entscheidend, Trans* Identität aus einer pathologisierenden Perspektive zu lösen – auch in der Therapie.
Minderheitenstress als Ursache, nicht die Identität selbst
Meyer verwies auf das Minderheitenstressmodell (Ilan Meyer, 2003), das Belastungen stigmatisierter sozialer Gruppen beschreibt. Zu dem sogenannten Minderheitenstress gehören Diskriminierung, Gewalt, gesellschaftlicher Ausgrenzung sowie Selbstablehnung aufgrund der Minderheiten-Identität. Zusätzlich können weitere allgemeine Stressfaktoren wie Arbeitsplatzverlust dazu führen, dass die psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigt wird. Fehlen entlastende Faktoren wie Gruppensolidarität, steigt das Risiko schwerer psychischer Erkrankungen wie Depressionen, Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) oder Suizidalität.
- Trans* Personen haben ein 7,7-fach höheres Risiko für Suizidgedanken.
- Jeder dritte trans* Teenager unternimmt einen Suizidversuch.
- Trans* Personen haben ein 2,6-fach höheres Risiko für Depressionen.
- Trans* Personen haben ein 2,6-fach höheres Risiko für eine PTBS.

„Psychische Störungen und prekäre Lebenssituationen entstehen nicht durch die Identität selbst, sondern durch gesellschaftliche Bedingungen“, sagte Meyer. In der Behandlung sei es entscheidend, der wissenschaftlich fundierten AWMF-S3-Leitlinie „Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit“ zu folgen. Diese sieht eine affirmative, partizipative und respektvolle Haltung bei Diagnostik, Beratung und Therapie vor. So bedeute etwa die Anerkennung gewählter Namen und Pronomen nicht nur Respekt, sondern schaffe auch einen sicheren Raum für die Behandlung. Zugleich müsse man betonen, dass ein erheblicher Teil der trans* Personen psychisch gesund seien und nicht unter psychischen Erkrankungen leiden.
Kritischer Blick auf Versorgungsrealitäten
Meyer kritisierte die Strukturen im Versorgungssystem. Die teils gängige Annahme, Trans* Identität beruhe auf einem gestörten Bewältigungsmechanismus einer Traumafolgestörung, sei wissenschaftlich unbelegt, halte sich aber hartnäckig – auch im Gesundheitswesen. Zudem fehle es weiterhin an ausreichendem Zugang zum Gesundheitssystem, was vor allem an Unsicherheiten in der Beratung und Behandlung von trans* Personen liege. Eine professionelle Haltung bedeute, diese Unsicherheiten zu akzeptieren und sich mit der eigenen Geschlechtsidentität sowie mit gesellschaftlichen Vorstellungen dazu in Supervision, Intervision und Selbsterfahrung auseinanderzusetzen.
Praxisnah und multiprofessionell
Neben den Vorträgen bot das Symposium ein breites Spektrum zur Vertiefung. Workshops und Praxisformate griffen Themen wie traumasensitives Yoga, Schematherapie im klinischen Alltag, Aromatherapie, Konzentrierte Bewegungstherapie sowie Borderline und Trauma auf – teils auch in Verbindung mit tiergestützter Therapie. Der Nachmittag machte deutlich, wie wichtig es ist, multiprofessionell zusammenzuarbeiten, die eigene Haltung zu reflektieren und sowohl Betroffenen als auch Behandelnden offene Räume zu bieten, um mit Traumafolgen umzugehen. Für viele Teilnehmer war das Symposium ein Impuls, gewohnte Sichtweisen zu hinterfragen und neue Wege in der traumatherapeutischen Versorgung zu denken.
Anzeige Anzeige
Anzeige