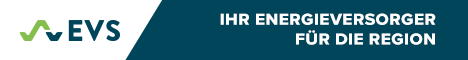Projekt „Leinen los, statt Anker setzen“ fördert echte Teilhabe

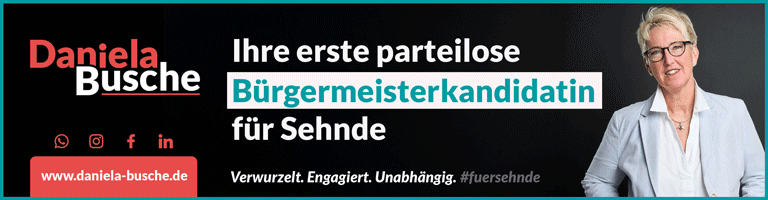
Wie gelingt der Übergang aus stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe in ein eigenständiges Leben? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines Projekts, das die Abteilung Forschung und Entwicklung vom Klinikum Wahrendorff im Frühjahr auf dem diesjährigen European Congress of Psychiatry (EPA 25) in Madrid und auf der 29. Sozialpsychiatrie-Tagung in Salzburg vorgestellt hat. Unter dem Titel „Leinen los, statt Anker setzen“ präsentierten die Beiträge ein praxisnahes Angebot von Wahrendorff Wohnen für Menschen mit seelischen und geistigen Behinderungen. Es unterstützt aktiv den Wechsel aus stationären Hilfen hin zu eigenständigem Wohnen, Arbeit und Bildung – und setzt dabei konsequent auf die Prinzipien der gemeindepsychiatrischen Versorgung.
Gemeindepsychiatrische Praxis verbessern
Das Projekt basiert auf der Einsicht, dass viele Bewohner stationärer Hilfen ein Leben in den eigenen vier Wänden anstreben, jedoch an strukturellen Hürden scheitern. Ähnliches gilt für den Einstieg in Ausbildung und Beruf. Hier greift das Projekt ein: Es kombiniert individuelle Beratung, Peer-Unterstützung (Begleitung durch Menschen mit vergleichbaren Erfahrungen), Gruppenangebote und aufsuchende Hilfe.
Seit Herbst 2024 haben über 40 Menschen das Angebot genutzt. Es setzt auf einen niederschwelligen Ansatz, der sich an der Lebensrealität der Teilnehmer orientiert. Das Projektteam umfasst Psychologen, Sozialarbeiter sowie Streetworker. In Zukunft wird das Team zudem durch zwei Genesungsbegleiter verstärkt. Eine begleitende Evaluation prüft, wie sich Lebensqualität, soziale Unterstützung und Teilhabe entwickeln. Alle Teilnehmer streben an, entweder in ein „normales“ Leben zurückzukehren oder es erstmals aufzubauen. Die Gruppe vereint Menschen mit unterschiedlichsten Erkrankungen. „Jeder kann offen seine Wünsche und Ziele einbringen, von den Erfahrungen der anderen profitieren und so die nächsten Schritte planen“, sagt Dr. Julia Krieger, Psychologin im Wahrendorff-Team für Forschung und Entwicklung. „Der Austausch mit Gleichgesinnten, das gemeinsame Feiern eigener und fremder Erfolge stärkt Hoffnung und Zuversicht. Es erleichtert, neue Perspektiven zu entwickeln – ein entscheidender Faktor im Recovery-Prozess.“
Personenzentrierte Hilfen mit Modellcharakter
Das Projekt will die gemeindepsychiatrische Versorgung mit personenzentrierten Hilfen voranbringen. Es verbindet professionelle Unterstützung mit Peer-Erfahrungen und zeigt, dass der Übergang aus stationären Hilfen gelingt – wenn er individuell begleitet und bedarfsorientiert gestaltet wird. Künftig soll das Angebot wachsen und auch anderen Regionen sowie Trägern der Eingliederungshilfe offenstehen. Kooperationen mit Bildungsträgern, Wohnungsanbietern und regionalen Arbeitgebern entstehen bereits.
Mehr Informationen gibt es im Internet, die Dissertation von Dr. Julia Krieger ist dort ebenfalls verfügbar.
Anzeige Anzeige
Anzeige